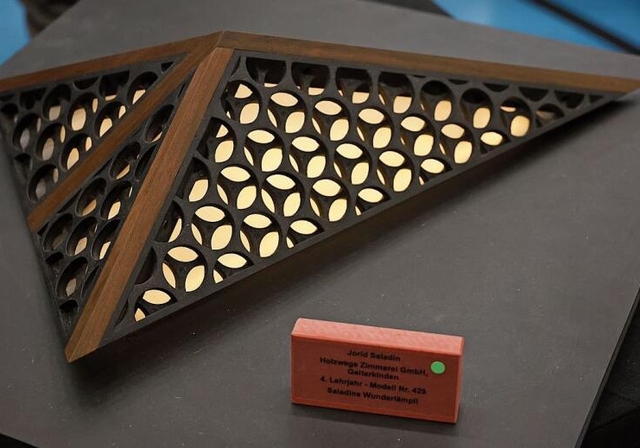Himmlische Musik – göttlich gespielt
Liestal Neues Orchester Basel mit Klarinettist Pavlos Serassis

Am Samstag konzertierte das Neue Orchester Basel unter Christian Knüsel mit dem Soloklarinettisten Pavlos Serassis in der Stadtkirche Liestal. Im Zentrum standen zwei Werke von Wolfgang Amadé Mozart. Das Konzert begann mit einem musikalischen Scherz, bei dem Mozartthemen durcheinandergewirbelt waren. Das berühmte Konzert für Klarinette in A-Dur, KV 622, wurde umrahmt von Kompositionen von Pavlos Serassis und Joseph Haydn.
Ein Orchestermitglied las aus einem Brief Mozarts aus dem Jahr 1788, in dem von den «schwarzen Gedanken» des Genies die Rede ist. Das musikalische Mosaik ohne Unterbrechungen begann mit Serassis’ «Schweigen und Hoffen», einer Verschmelzung von Melodien aus dem Klarinettenkonzert und anderen Motiven aus der NOB-Saison 24/25. Im Allegro des Klarinettenkonzerts spielte Pavlos Serassis dynamisch und agogisch differenziert und auch im Pianissimo sauber und klar.
Die ganze Klangpalette in allen Lagen war ein Hörgenuss für das aufmerksame Publikum. Die Heiterkeit des 1. Satzes kippte abrupt in «Die Vorstellung des Chaos» aus Haydns «Die Schöpfung», die psychologisch die schwierige biografische Situation Mozarts im Jahre 1791 hörbar machen sollte.
Aus diesem Tohuwabohu schälte sich wie eine elysische Offenbarung die herrliche Klarinettenkantilene des Adagios heraus, das den meisten als Filmmusik von «Out of Africa» (1985) bekannt sein dürfte. Nahtlos ging das Adagio in ein kurzes Klezmer Intermezzo von Serassis über, dem das heitere, vorwärtsdrängende und optimistische Rondo und Allegro folgten. Das Orchester zeigte hohe Präsenz und Leichtigkeit im Spiel. In dieser raffinierten Stückabfolge glaubte man, das Klarinettenkonzert zum ersten Mal gehört zu haben.
«Jupitersinfonie» als krönender Abschluss
Wolfgang Amadé Mozarts letzte Sinfonie, die Nr. 41, KV 551, erhielt den Namen «Jupiter-Sinfonie» erst 1819. Sie gilt zurecht als Kulminationspunkt des klassischen Sinfonieschaffens. Für Mozarts Zeitgenossen war dieses Werk zu komplex. «Die Kontraste peinigten das Ohr», hiess es damals, und der Schweizer Kritiker Hans Georg Nägeli entdeckte in den letzten Sinfonien Mozarts nur «widerwärtige Styllosigkeit»! In der Jupiter-Sinfonie findet sich «eine Kombination von Vielfalt und Einheit», wie Christian Knüsel erklärte, der sehr subtil, aber auch klar dirigierte und mit seinem Körpereinsatz die Energieimpulse für die Musizierenden gab. Das Allegro vivace gibt sich teils leicht und flockig, teils dramatisch. Im Andante cantabile liess Knüsel das Orchester wirklich singen, und das Menuetto – Allegro wurde elegant und wiegend interpretiert.
Den Höhepunkt bildet das grossartige Molto Allegro des Schlusssatzes, in dem fünf Motive in dichtester Kontrapunktik ineinander verwoben sind. Es ist eine olympische musikalische Apotheose, die mit einem ähnlich olympischen Applaus verdankt wurde.